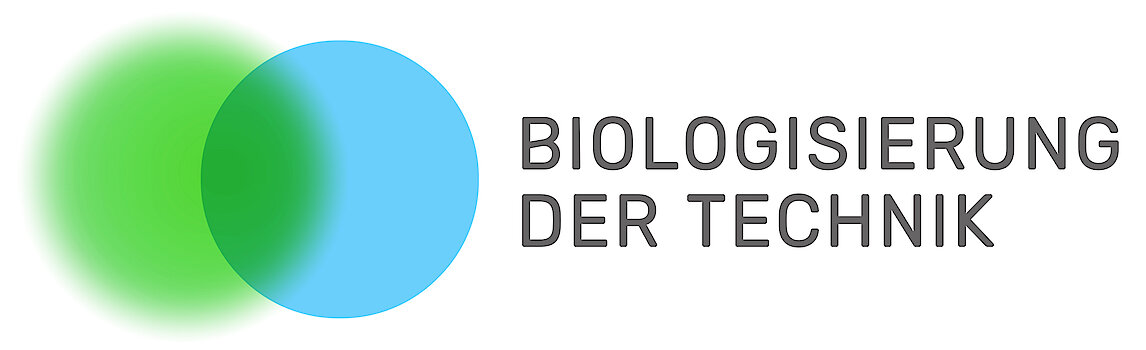Die Digitalisierung bioinspirierter Materialdaten steht vor einer besonderen Hürde: Die Beschreibung biologischer Vorbilder und die Beschreibung technischer Werkstoffe folgen sehr unterschiedlichen Sprachen. Während die Biologie häufig auf beschreibende, kontextsensitive Sprache setzt, nutzen Ingenieurwissenschaften standardisierte Terminologie, um möglichst leicht rekonstruierbare Ergebnisse zu erzielen. Diese Kluft erschwert die eindeutige Erfassung und Verknüpfung von Daten – eine Grundvoraussetzung für reproduzierbare Forschung und datengetriebene Innovationen.
Ontologien als Lösungsansatz
Ontologien bieten hier einen verbindenden Ansatz: Sie definieren Begriffe und beschreiben die Beziehungen zwischen ihnen, sodass biologische und technische Perspektiven integriert werden können. So lassen sich z. B. biologische Funktionen wie „selbstheilend“ in ihrer Funktion eindeutig beschreiben (Fähigkeit eines Systems, strukturelle Integrität nach Schädigung wiederherzustellen) und systematisch mit Werkstoffklassen (Polymere, Komposite etc.) und technischen Eigenschaften (Rissheilungsrate, Duktilität, molekulare Reversibilität, Diffusionsrate etc.) verknüpfen. Das erleichtert nicht nur die Dokumentation und den Austausch von Daten, sondern eröffnet auch neue Innovationspfade, indem über Disziplingrenzen hinweg Zusammenhänge sichtbar werden.
Aktueller Stand von Ontologien für bioinspiriertes Design
Für die Digitalisierung bioinspirierter Materialdaten fehlen bislang ausgereifte Ontologien, die die unterschiedlichen Sprachen und Konzepte von Biologie und Technik konsistent zusammenführen. Existierende Ressourcen wie Taxonomien, Thesauri oder domänenspezifische Ontologien sind häufig inkonsistent, nicht ausreichend dokumentiert und nicht interoperabel.
Ontologien können hier trotzdem einen entscheidenden Beitrag leisten. Als formale Wissensmodelle ermöglichen sie es, biologische Funktionen, Arbeitsprinzipien und Konstruktionen präzise mit technischen Begriffen und Materialeigenschaften zu verknüpfen. So können interoperable, maschinenlesbare Datenstrukturen entstehen, die nicht nur den Austausch zwischen Fachgebieten erleichtern, sondern auch neue Ansätze für datengetriebene Forschung und Entwicklung eröffnen.
Derzeit existieren zwar einzelne Ansätze wie die „Unified Ontology for Causal–Function Modeling in Biologically Inspired Design“ (UNO-BID) oder die „BioMimetic Ontology“ (BMO), doch keine dieser Lösungen erfüllt die Anforderungen an logischer Konsistenz, Standardisierung und Verfügbarkeit. Um das volle Potenzial digitaler Daten in biologisierter Technik zu heben, braucht es daher eine klar definierte, FAIR-konforme Referenzontologie, die von der Community weiterentwickelt und gepflegt wird. Sie würde die Grundlage für eine vernetzte, nachvollziehbare und innovationsfördernde Datennutzung schaffen.
Eine aktuelle Übersicht über bestehende Ontologien für bioinspiriertes Design können in Yargan und Jansen (2025) nachgeschlagen werden.
Ausblick: Pilotprojekte und laufende Arbeiten
Um diese Lücke zu schließen, starten mehr und mehr Pilotprojekte innerhalb der Plattform MaterialDigital, die sich gezielt mit der Digitalisierung von Teilgebieten bioinspirierter Materialdaten beschäftigen. Grundlage dafür sind die Bedarfe und Ansätze, die aktuell durch die laufenden Verbundprojekte der Fördermaßnahme „Biologisierung der Technik“ erarbeitet werden.
Auch auf Seiten der NFDI-MatWerk-Initiative laufen bereits verwandte Arbeiten in diese Richtung: Das Participant Project P22 „Engineered Living Materials with Adaptive Functions“ widmet sich der Entwicklung neuer Dokumentationsrichtlinien und Workflows für Materialien und Prozesse mit SELF-X-Prinzipien. Diese setzen auf standardisierte Begriffe und Datenstrukturen und unterstützen damit langfristig datengetriebene Entwicklungsansätze.
Mit diesen Maßnahmen werden die Voraussetzungen geschaffen, um die digitale Erschließung, Verknüpfung und innovative Nutzung bioinspirierter Materialdaten in Zukunft deutlich zu verbessern.
Weiterlesen: Warum Digitalisieren?
Biologisierung der Technik
Gefördert vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt - FKZ: 13XP5205
Biologisierung der Technik
Gefördert vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt - FKZ: 13XP5205