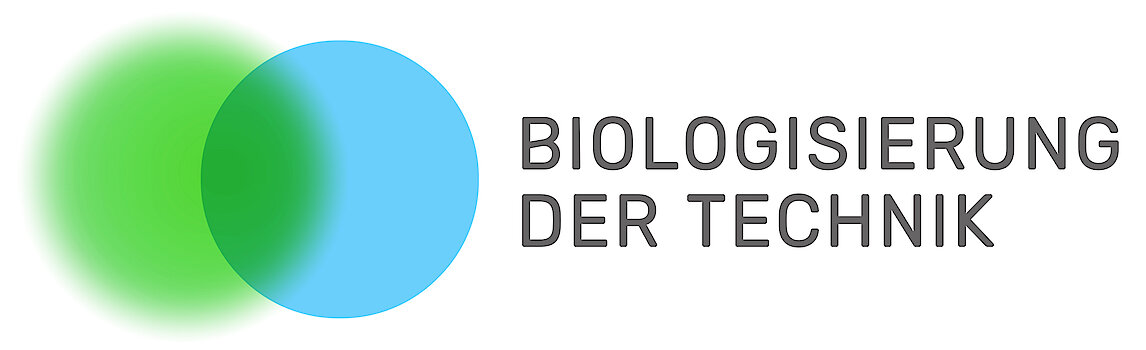Die Entwicklung bioinspirierter Materialien zählt zu den spannendsten Innovationsfeldern unserer Zeit – voller Potenzial für Technik, Medizin und Industrie. Doch um dieses Potenzial voll auszuschöpfen, braucht es mehr als exzellente Forschung: Es braucht eine neue Denkweise im Umgang mit Daten. Im Folgenden wird gezeigt, wie Digitalisierung Forschung effizienter, transparenter und zukunftsfähiger macht – und wie strukturierte Daten nicht nur die Wissenschaft bereichern, sondern auch den Weg für KI-Anwendungen und industrielle Innovationen ebnen. Wer die Chancen nutzt, gestaltet den Fortschritt aktiv mit.
Warum digitalisieren?
Mit bioinspirierten Materialien entstehen völlig neue Möglichkeiten für technische, medizinische und industrielle Anwendungen – doch auch neue Fragen. Ihre komplexen Eigenschaften und Strukturen stellen Forschende vor große Herausforderungen: Wie lassen sich die enormen Datenmengen aus Experimenten, Simulationen und Charakterisierungen effizient und langfristig nutzen? Wie können Ergebnisse reproduzierbar, zugänglich und anschlussfähig gemacht werden? Hier setzt die Digitalisierung an: Sie schafft eine neue Infrastruktur für Forschende, Entwickler und Anwender. Tägliche Arbeitsroutinen werden nicht nur verbessert, sondern auch vereinfacht und sogar nachvollziehbar. Es entsteht so die Grundlage, Daten systematisch über ihren gesamten Lebenszyklus zu managen, ihre Qualität zu sichern und ihren Mehrwert zu steigern – für die Forschung und darüber hinaus.
Daten und ihr Lebenszyklus: Mehr als nur speichern
Daten sind heute mehr als bloße Nebenprodukte wissenschaftlicher Arbeit. Sie werden zunehmend selbst zum zentralen Wertträger der Forschung. Der Data Life Cycle beschreibt diesen Prozess in aufeinander abgestimmten Phasen: von der Erhebung über die Aufbereitung, Speicherung und Nutzung bis hin zur langfristigen Archivierung und Nachnutzung. Wer schon bei der Erzeugung von Daten Metadaten erfasst und Standards einhält, erleichtert nicht nur die eigene Arbeit, sondern macht seine Ergebnisse für andere zugänglich und wiederverwendbar.
Für diesen Ansatz stehen die FAIR-Prinzipien: Daten sollen auffindbar, zugänglich, interoperabel und wiederverwendbar (Findable, Accessible, Interoperable und Reusable) sein. Damit sie diese Eigenschaften erreichen, sind strukturiertes Forschungsdatenmanagement (FDM) und geeignete Tools unverzichtbar. Auf forschungsdaten.info finden sich kompakte Erklärungen der wichtigsten Begriffe, eine Übersicht hilfreicher Tools und Antworten auf häufige Fragen. Die internationalen GO FAIR-Prinzipien bieten zudem einen etablierten Rahmen für die Umsetzung in der Praxis.
Förderinitiativen: Vernetzte Infrastrukturen
Die Fördermaßnahme „Biologisierung der Technik“ profitiert von nationalen Digitalisierungsinitiativen, die moderne Dateninfrastrukturen aufbauen. Zwei zentrale Initiativen in Deutschland sind:
MaterialDigital (PMD): Die Plattform MaterialDigital entwickelt Konzepte und Technologien, um Daten im Bereich der Materialwissenschaften systematisch für Anwender nutzbar zu machen. Ziel ist es, digitale Datenräume für Werkstoffe und Materialien im industriellen Kontext zu schaffen, die eine vernetzte, interdisziplinäre Forschung erleichtern.
- NFDI-MatWerk: Die Nationale Forschungsdateninfrastruktur für Materialwissenschaft und Werkstofftechnik (NFDI-MatWerk) baut eine nationale Infrastruktur für Forschungsdaten auf, das Standards für die Erfassung, Analyse, Speicherung und Nachnutzung von Daten in der akademischen Werkstoffforschung setzt. Damit unterstützt sie die Community dabei, Daten nach den FAIR-Prinzipien zu speichern und über Fachgrenzen hinweg zu teilen.
Diese Infrastrukturen legen den Grundstein dafür, dass Daten zu bioinspirierten Materialien langfristig für die Entwicklung, Simulation und Optimierung verfügbar bleiben.
Wer profitiert von der Digitalisierung?
Digitalisierung zahlt sich aus – für die Forschung, für innovative KI-Anwendungen, für die Industrie und sogar für die Umwelt. Sie erleichtert die Handhabung von Daten und macht sie verständlich, auffindbar und wiederverwendbar. Was bedeutet das konkret für die beteiligten Gruppen?
Forschende: Effizienter forschen, besser verstehen
Für Wissenschaftler*innen bietet die Digitalisierung gleich mehrere Vorteile:
Sie können Daten und Metadaten systematisch erfassen, strukturieren und in allen Phasen des Datenlebenszyklus effizient verwalten.
Durch einheitliche Standards und FAIR-konforme Speicherung können bestehende Datenbestände problemlos wiederverwendet und mit neuen Datensätzen kombiniert werden.
Simulationen und datengetriebene Modellierungen profitieren enorm von gut dokumentierten Daten. So lassen sich auf dieser Basis auch digitale Zwillinge von bioinspirierten Werkstoffen erzeugen – virtuelle Abbilder, die komplexe Materialverhalten vorhersagen und optimieren helfen.
Der Zugang zu strukturierten Daten beschleunigt Publikationsprozesse, erhöht die Reproduzierbarkeit von Forschungsergebnissen und erleichtert interdisziplinäre Zusammenarbeit.
KI-Anwendungen: Von Daten lernen
Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen eröffnen der Materialforschung neue Möglichkeiten, Zusammenhänge in großen Datenmengen zu erkennen. Dies gelingt nur, wenn die Daten in maschinenlesbarer, interoperabler Form vorliegen. Digitale Dateninfrastrukturen liefern genau diese Voraussetzung. So können Algorithmen auf strukturierte Materialdaten trainiert werden, um beispielsweise optimale Strukturen für bioinspirierte Werkstoffe vorherzusagen oder neue Designideen vorzuschlagen. Je besser der Datenbestand gepflegt ist, desto effizienter und präziser werden die Ergebnisse solcher KI-gestützten Ansätze.
Industrie: Innovationen schneller und nachhaltiger umsetzen
Auch Unternehmen profitieren von digitalen Infrastrukturen. Sie können Forschungsergebnisse gezielt aufgreifen, Entwicklungszeiten verkürzen und das Risiko von Fehlentwicklungen senken. Das spart nicht nur Zeit, sondern auch wertvolle Rohstoffe, die für Forschung und Entwicklung benötigt werden. Auch Kollaborationen werden gestärkt, indem Unternehmen ihren Partnern sicheren und selektiven Zugang zu Daten gewähren können. Zugängliche Daten beschleunigen den Technologietransfer und ermöglichen eine verlässliche Dokumentation über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg. Im Bereich bioinspirierter Materialien eröffnet dies Chancen für neuartige Produkte, deren Eigenschaften an natürliche Vorbilder angelehnt sind – von belastbaren Leichtbaustrukturen bis zu selbstheilenden Oberflächen. Durch den Zugriff auf konsistente Datensätze können Unternehmen frühzeitig fundierte Entscheidungen treffen und neue Marktsegmente erschließen.
Fazit
Die Digitalisierung ist kein Selbstzweck. Sie vereinfacht den Umgang mit Daten und stellt gleichzeitig sicher, dass die wachsende Menge an Daten aus der Forschung zu bioinspirierten Materialien auch langfristig nutzbar bleibt. Wer von Anfang an den Datenlebenszyklus berücksichtigt, FAIR-Prinzipien umsetzt und vernetzte Infrastrukturen nutzt, schafft eine solide Basis für innovative Forschung, KI-basierte Entwicklung und nachhaltige industrielle Anwendungen.
Weiterlesen: Herausforderungen in der Digitalisierung bioinspirierter Materialdaten
Biologisierung der Technik
Gefördert vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt - FKZ: 13XP5205
Biologisierung der Technik
Gefördert vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt - FKZ: 13XP5205